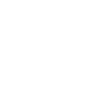Probiotische Bakterien sind zur Behandlung von Darmerkrankungen längst bekannt, werden aber auch viel kritisiert. Was sind die Kritikpunkte und gibt es dank koreanischer Forscher und Forscherinnen bald eine Lösung?
Unsere Darmflora besteht aus unzähligen Mikroorganismen, die etwa 1.000 verschiedenen Arten angehören. Einige von ihnen können entweder entzündungshemmend oder entzündungsfördernd wirken. Unser Immunsystem registriert dies und reagiert entsprechend. Sogenannte probiotische Bakterien wirken entzündungshemmend.
Aus diesem Grund wird schon seit einiger Zeit versucht, entzündliche Darmerkrankungen mit probiotischen Bakterien zu behandeln. Sie sollen die Abwehrreaktion des Immunsystems unterdrücken und damit gegen die Autoimmunreaktion wirken.
Wie wirken probiotische Bakterien?
Probiotische Bakterien (Probiotika) regen die Produktion der sogenannten T-Zellen an. Das sind Immunzellen, die die Abwehrreaktion des Immunsystems dämpfen. Damit wirken sie Autoimmunerkrankungen und chronischen Entzündungen, wie Morbus Crohn und Colitis ulcerosa, entgegen.
Welche neuen Erkenntnisse gibt es?
Gemäß einer Ende 2018 veröffentlichten Studie haben koreanische Forscher:innen neue Erkenntnisse gewonnen, die die Behandlung mit Probiotika deutlich verbessern könnten.
Mit Hilfe von Zellkulturen wurden verschiedene Stämme probiotischer Bakterien auf ihre Fähigkeit zur Bildung von T-Zellen getestet. Dabei erwies sich ein Stamm des Bifidobacterium bifidum als besonders vielversprechend: Die Bakterien wurden in den Darm keimfrei aufgezogener Mäuse eingesetzt. Innerhalb von drei Wochen zeigte sich eine deutlich gesteigerte Produktion der T-Zellen.
Anhand chemischer Analysen konnten die Forschenden die dafür verantwortlichen Strukturen identifizieren. Demnach wird die verstärkte Produktion entzündungshemmender Immunzellen durch bestimmte Bestandteile der Zellwand des Bifidobacterium bifidum ausgelöst. Es handelt sich hierbei um spezielle Polysaccharide (Vielfachzucker).
Die Polysaccharide aktivieren bestimmte Immunzellen, sogenannte dendritische Zellen. Diese setzen wiederum Botenstoffe frei, wodurch die Produktion der T-Zellen angeregt wird.
Diese Immunreaktion unterscheidet sich nicht, egal ob sie von einem lebensfähigen Bakterium oder den reinen Polysacchariden ausgelöst wird.
Was spricht gegen den Einsatz von probiotischen Bakterien?
Die Polysaccharide lösen also die gleiche Immunreaktion aus wie die probiotischen Bakterien an sich. Demnach könnte auf den Einsatz lebensfähiger probiotischer Bakterien verzichtet werden. Aufgrund der vorhandenen Kritikpunkte und Nebenwirkungen von Probiotika wäre das ein entscheidender Vorteil.
Es ist nämlich so, dass probiotische Bakterien meist nur für kurze Zeit im Darm verweilen und entsprechend nur in dieser kurzen Zeit wirken können. Das ist abhängig von der individuellen Darmflora. Zum Beispiel kann es nach einer Antibiotika-Behandlung sein, dass ein bestimmter Bakterienstamm im Darm „abgestorben“ ist. In dem Fall müssten genau diese Bakterien ersetzt werden. Neu hinzugefügte Bakterien einer Spezies, die bereits in ausreichender Anzahl im Darm angesiedelt ist, können sich nicht zusätzlich ansiedeln. Vor einer effektiven Probiotika-Behandlung ist also eine individuelle Analyse der Darmflora erforderlich.
Zudem wurden auch Fälle von Nebenwirkungen probiotischer Bakterien berichtet. So kommt es vor, dass probiotische Bakterien durch das Freisetzen von Milchsäure zu Blähungen und Bauschmerzen führen.
Bei Patient:innen mit einer chronisch entzündlichen Darmerkrankung (CED) findet sich im Vergleich zu Gesunden eine geringere Anzahl des Bakteriums Bifidobacterium bifidum. Eine Ansiedelung hinzugefügter Bakterien ist also grundsätzlich möglich. Durch die Verwendung der Polysaccharide kann zudem den Nebenwirkungen vorgebeugt werden. Die Voraussetzungen für eine wirkungsvolle Behandlung sind also gegeben.
Quellenangaben
- Maldonado-Gómez, M. X. et al. (2016). Stable Engraftment of Bifidobacterium longum AH1206 in the Human Gut Depends on Individualized Features of the Resident Microbiome. Cell Host & Microbe, 20 (4). S. 55-526.
- Verma, R. et al. (2018). Cell surface polysaccharides of Bifidobacterium bifiduminduce the generation of Foxp3+ regulatory T cells. Science Immunology, 3 (28).